und Naturwissenschaften
Mit dem Klimawandel verschwinden die Lebensräume in Seen
3. Juni 2021, von Heiko Fuchs

Foto: pixabay
Die globale Erwärmung erhöht die Temperaturen von Seen weltweit. Finden die dort lebenden Arten noch die Temperaturen vor, die sie zum Überleben brauchen? Ein internationales Team unter Leitung des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) und Beteiligung der Universität Hamburg haben langfristige Temperaturveränderungen in 139 Seen untersucht, was rund 69 Prozent des weltweiten Volumens der Süßwasserlebensräume der Erde entspricht. Sie zeigen eine deutliche Verschiebung der Temperaturlebensräume, die einzelne Arten zum Überleben benötigen. Durch die Erwärmung der Seen müssen Arten in andere Tiefen ausweichen oder ihr jahreszeitliches Auftreten umstellen, um ihren Ansprüchen an die Temperatur gerecht zu werden. Nicht alle werden in der Lage sein, diesen Wechsel zu vollziehen. Die Studie wurde heute in Nature Climate Change veröffentlicht.
Die meisten Lebewesen im Wasser sind wechselwarm – das heißt, sie passen ihre Temperatur an die Umgebungstemperatur des Wassers an. Dabei hat jede Art ihren individuellen Temperaturbereich, an den ihre Körperfunktionen wie Stoffwechsel und Fortpflanzung angepasst sind. Dieser Temperaturbereich bestimmt somit weitgehend, in welcher Tiefe und wann im Jahresverlauf Arten in Seen vorkommen.
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler untersuchten, wie sich Temperaturlebensräume in Seen als Reaktion auf den Klimawandel bereits verändert haben – ob sie geschrumpft sind oder sich ausgedehnt haben. Dazu analysierten sie mehr als 32 Millionen Temperaturmessungen unterschiedlicher Wassertiefen – sogenannte Tiefenprofile – von 139 Seen weltweit. Sie bestimmten den Unterschied zwischen den aktuellen Seetemperaturen im Vergleich zu einer früheren Basisperiode. Die Veränderung der Temperaturlebensräume wurde als der Prozentsatz bestimmt, der beim Vergleich der beiden Zeiträume verloren ging oder gewonnen wurde.
Für weniger anpassungsfähige Arten reduzieren sich die Lebensräume um fast 20 Prozent
Langfristige Änderungen der Wassertemperaturen führten zu einer durchschnittlichen Differenz von 6,2 Prozent der Temperaturlebensräume zwischen den Zeiträumen 1978-1995 und 1996-2013. Die Differenz der Temperaturlebensräume stieg sogar auf durchschnittlich 19,4 Prozent für Beispielarten, die auf eine Jahreszeit und eine Wassertiefe beschränkt sind.
Die Veränderung der Temperaturlebensräume ist für Arten, die in einem breiten Temperaturbereich vorkommen können, kein Problem, aber nicht alle Arten sind so anpassungsfähig.
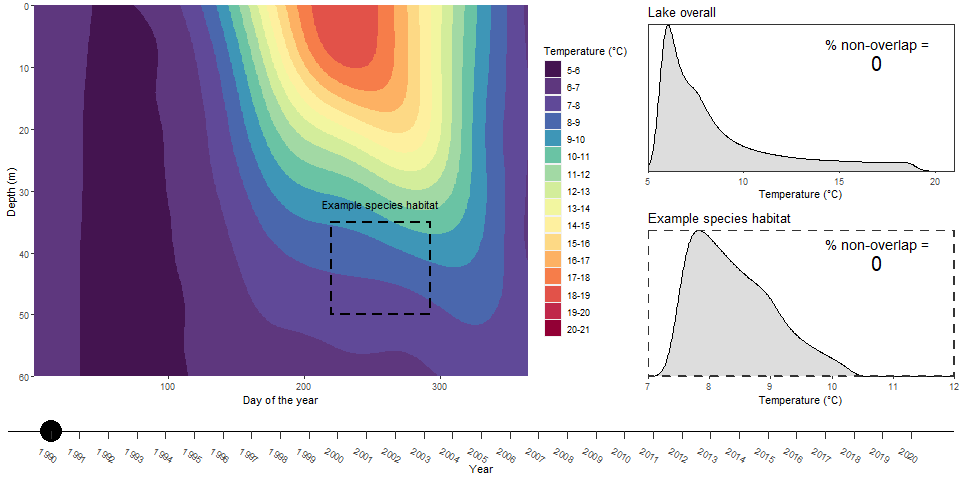
Es ist schwierig, wechselnden Umweltbedingungen zu entkommen
Arten können mit dem Temperaturanstieg zurechtkommen, indem sie ihre Saisonalität oder ihre Aufenthaltstiefe innerhalb der Wassersäule ändern. Diese Anpassungen können jedoch durch ökologische Wechselwirkungen, Lebensansprüche oder begrenzte Ressourcen eingeschränkt sein. Viele Fische z. B. können tiefere, kühlere Regionen von Seen nicht besiedeln, wenn es dort nicht ausreichend Sauerstoff gibt. Dass der Sauerstoffgehalt gerade in tieferen Schichten von Seen weltweit abnimmt, hat eine andere Studie, die gestern in Nature erschienen ist, gezeigt.
Das Schrumpfen und die Ausdehnung der Temperaturlebensräume machen deutlich, wie dramatisch sich der fortschreitende Klimawandel auf die Lebensgemeinschaften und die Biodiversität von Seen auswirken könnte, sodass heimische Arten in ihrer Existenz bedroht werden und sich invasive Arten besser ausbreiten können.
Seen in den Tropen sind besonders betroffen
Erwartungsgemäß wiesen Arktische Seen und Seen in gemäßigten Breiten eine hohe Verschiebung der Temperaturlebensräume auf, da in diesen Seen die Erwärmung der oberen Wasserschichten tendenziell höher ist. Überraschend war aber die Tatsache, dass tropische Seen noch wesentlich höhere thermische Verschiebungen zeigten. „Deshalb sind die Datenerhebung und Analyse von tropischen Gewässern umso wichtiger, denn diese sind zurzeit unterrepräsentiert. So gibt es z. B. in der Studie keinen einzigen Datenpunkt für Gewässer in Südamerika“ sagt Priv.-Doz. Dr. Dörthe Müller-Navarra vom Fachbereich Biologie der Universität Hamburg, Mitautorin der Studie.
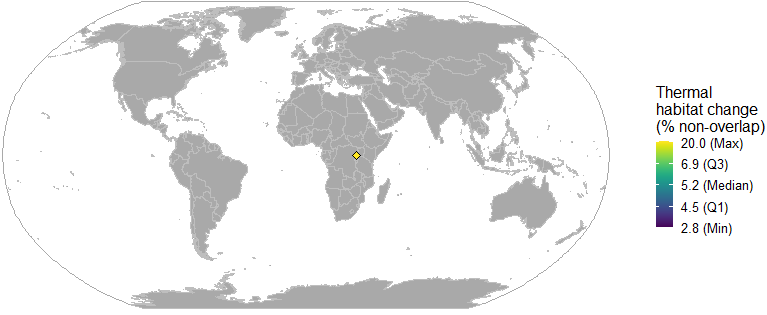
Die internationale Studie ist Teil der GLEON-Initiative (Global Lake Ecological Observatory Network). An ihr waren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus Australien, Belgien, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Japan, Kanada, Neuseeland, Norwegen, Österreich, Russland, Schweden, der Schweiz und den Vereinigten Staaten beteiligt.
Text: IGB, red.
Original Publikation
Climate change drives widespread shifts in lake thermal habitat,
Benjamin M. Kraemer, Rachel M. Pilla, R. Iestyn Woolway, Orlane Anneville, Syuhei Ban, William Colom-Montero, Shawn P. Devlin, Martin T. Dokulil, Evelyn E. Gaiser, K. David Hambright, Dag O. Hessen, Scott N. Higgins, Klaus D. Jöhnk, Wendel Keller, Lesley B. Knoll, Peter R. Leavitt, Fabio Lepori, Martin S. Luger, Stephen C. Maberly, Dörthe C. Müller-Navarra, Andrew M. Paterson, Donald C. Pierson, David C. Richardson, Michela Rogora, James A. Rusak, Steven Sadro, Nico Salmaso, Martin Schmid, Eugene A. Silow, Ruben Sommaruga, Julio A. A. Stelzer, Dietmar Straile, Wim Thiery, Maxim A. Timofeyev, Piet Verburg, Gesa A. Weyhenmeyer, and Rita Adrian,
Nat. Clim. Chang. (2021).
DOI: https://doi.org/10.1038/s41558-021-01060-3


