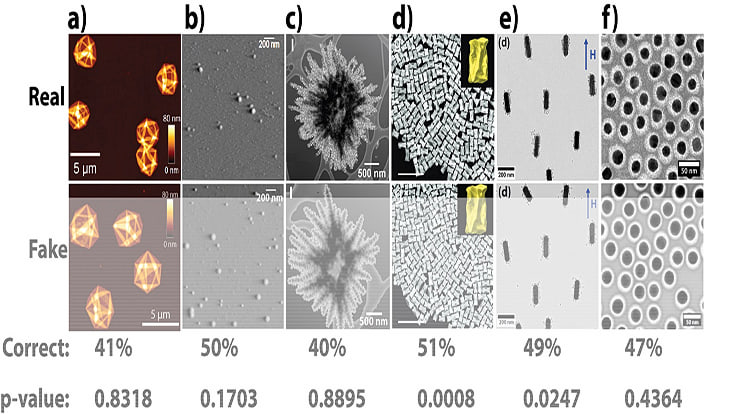und Naturwissenschaften
Frühes UniversumGigantische Kollisionen von Galaxienhaufen entdeckt
2. November 2020, von Heiko Fuchs

Foto: PanSTARRS/NASA/Chandra/LOFAR
Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung der Hamburger Sternwarte der Universität Hamburg hat neun gigantische Zusammenstöße von Galaxienhaufen kartiert. Es ist das erste Mal, dass Kollisionen von so weit entfernten Galaxienhaufen untersucht werden konnten. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler veröffentlichen nun ihre Ergebnisse in der Zeitschrift „Nature Astronomy“.
Galaxienhaufen sind die größten Strukturen im Universum. Sie können aus Tausenden von Galaxien bestehen, jede mit Milliarden von Sternen. Wenn solche Haufen verschmelzen, werden die Elektronen zwischen ihnen fast auf Lichtgeschwindigkeit beschleunigt. Die beschleunigten Teilchen senden Radiowellen aus, wenn sie mit Magnetfeldern in den Haufen in Kontakt kommen.
Bisher waren Teleskope nicht leistungsfähig genug, um Radiowellen von weit entfernten kollidierenden Haufen zu empfangen. Doch mit Hilfe des europäischen Antennen-Netzwerks des Radioteleskops Low Frequency Array (LOFAR) und einer „Belichtungszeit“ von acht Stunden pro Haufen, konnten die Forschenden erstmals detaillierte Daten von sehr weit entfernten Haufen sammeln und Haufen-Kollisionen beobachten, die bereits vor sieben Milliarden Jahren stattgefunden haben.
Die Daten zeigen unter anderem, dass die Radiostrahlung von weit entfernten kollidierenden Haufen heller ist, als bisher erwartet. Nach vorherrschenden Theorien geht die Radiostrahlung von Elektronen aus, die durch turbulente Strömungen von Gas beschleunigt werden. Offenbar sind die Turbulenzen und Wirbel, die durch die Kollisionen verursacht werden, stark genug, um auch in einem frühen Universum die Teilchen stark zu beschleunigen.
Außerdem erwiesen sich die Magnetfelder in den entfernten Haufen als etwa so stark wie in nahe gelegenen Haufen. Laut Mitautor Prof. Dr. Marcus Brüggen vom Fachbereich Physik der Universität Hamburg ist das eine faszinierende Entdeckung: "Diese Arbeit zeigt zum ersten Mal, dass der Weltraum in einem jungen Universum bereits mit Magnetfeldern gefüllt ist und wir nicht wirklich wissen, was sie verursacht. In Hamburg haben wir das Projekt mitgestaltet und die theoretische Interpretation der Beobachtungen geleitet.“
Original Publikation
Fast magnetic field amplification in distant galaxy clusters,
G. Di Gennaro, R. J. van Weeren, G. Brunetti, R. Cassano, M. Brüggen, M. Hoeft, T. W. Shimwell,
H. J. A. Röttgering, A. Bonafede, A. Botteon, V. Cuciti, D. Dallacasa, F. de Gasperin, P. Domínguez-Fernández, T. A. Enßlin, F. Gastaldello, S. Mandal, M. Rossetti, A. Simionescu,
Nature Astronomy (2020).
Weitere Informationen zu LOFAR
Das Low Frequency Array ist eine Anordnung von vielen europäischen Radioteleskopen, deren Signale zu einem einzigen Signal kombiniert werden. Deutschland ist neben den Niederlanden mit sechs Stationen der größte internationale Partner bei LOFAR. Die Radio-Teleskop-Stationen werden von der Ruhr-Universität Bochum, der Universität Hamburg, der Universität Bielefeld, dem Max-Planck Institut für Radioastronomie in Bonn, dem Max-Planck Institut für Astrophysik in Garching, der Thüringer Landessternwarte und dem Astrophysikalische Institut Potsdam betrieben. Gefördert wird LOFAR in Deutschland von der Max-Planck-Gesellschaft, dem Bundesministerium für Bildung und Forschung, den jeweiligen Bundesländern und von der Europäischen Union.